Stromausfall in Spanien und Portugal: Ursachenforschung läuft weiter
Großflächiger Stromausfall in Spanien und Portugal: Ein Cyberangriff ist möglich, doch was könnte sonst noch die Ursache für den Blackout sein? Die Suche läuft weiter.
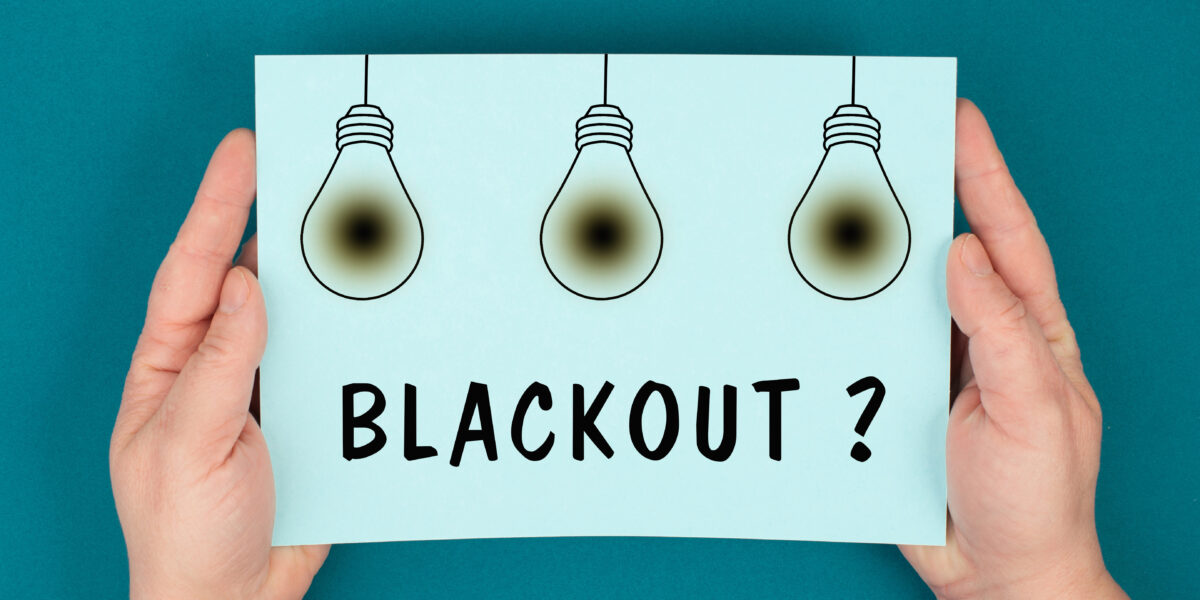
Plötzlich war der Strom weg: Millionen Menschen auf der Iberischen Halbinsel sind von einem massiven Blackout betroffen.
Foto: PantherMedia / Berit Kessler
Am Montagmittag erfasste ein massiver Stromausfall große Teile Spaniens und Portugals. Auf dem Festland der Iberischen Halbinsel fielen Ampeln, Züge und Mobilfunknetze aus. Auch Veranstaltungen wie das renommierte Masters-1000-Tennisturnier in Madrid mussten unterbrochen werden. Der spanische Stromnetzbetreiber Red Eléctrica meldete auf der Plattform X, dass die Versorgung in vielen Regionen, darunter Katalonien, das Baskenland und Kastilien, bereits wiederhergestellt sei. Dennoch könne es laut der spanischen Zeitung El País noch sechs bis zehn Stunden dauern, bis das Stromnetz vollständig stabilisiert ist.
Ministerpräsident Pedro Sánchez berief umgehend eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. In einer Fernsehansprache bat er die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und Handys sowie Notrufnummern nur im Ernstfall zu nutzen. Mittlerweile fließt der Strom fast überall auf der Iberischen Halbinsel wieder. Die spanische Justiz teilte am Dienstag mit, dass sie „Sabotage“ als Ursache des Stromausfalls prüfen würde. Solarstrom könnte aber auch der Grund gewesen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Update 1. Mai: War Solarstrom die Ursache?
- Update 30. April: Stromausfall forderte drei Todesopfer
- Stromausfall in Spanien führt zu Milliardenschäden
- Update 29. April: 99 % der Stromversorgung in Spanien wiederhergestellt
- Fünf Sekunden reichten aus, um das Land in Chaos zu versetzen
- Womit hätte ein Stromausfall dieser Größenordnung verhindert werden können?
- Der Stromausfall steht nicht im Zusammenhang mit einer „Dunkelflaute“
- Kann die eigene Solaranlage bei Stromausfall helfen?
- Meldung vom 28. April: Cyberangriff? Hinweise fehlen
- Technische Ursachen rücken in den Fokus
- Ist die Insel- bzw. Halbinsellage der Grund?
- Experte warnt vor Kaskadeneffekten und fordert stärkere Absicherung
- Folgen des Stromausfalls
- Auswirkungen auf Verkehr und Energieversorgung
- Spanien erlebt kritische Stunden
Update 1. Mai: War Solarstrom die Ursache?
Nach dem Blackout auf der Iberischen Halbinsel kursieren einige Theorien darüber, was genau passiert ist. Eine Sabotage kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, vielleicht war aber auch Solarstrom die Ursache. Innerhalb von weniger als zwei Sekunden registrierte der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica zwei Ereignisse, die eine automatische Abschaltung der Stromerzeugung auslösten.
Der erste Zwischenfall konnte noch abgefangen werden. Beim zweiten versagte das System. Eduardo Prieto, Betriebsdirektor bei Red Eléctrica, erklärte gegenüber Medien: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um Strom aus Solaranlagen handelte.“ Besonders in der Region Extremadura, wo der Vorfall begann, ist die Photovoltaik stark vertreten.
Erneuerbare Energie boomt – das Stromnetz hinkt hinterher
Spanien ist europaweit Vorreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien. 2024 machten diese etwa 66 % der gesamten installierten Leistung aus. Photovoltaik allein trägt über 32.000 Megawatt zur Stromerzeugung bei – mehr als Windkraft. Rund ein Viertel der gesamten Energiekapazität entfällt mittlerweile auf Solarstrom, meldete Red Eléctrica im Februar 2025.
Doch diese Entwicklung bringt Herausforderungen. Während die Stromproduktion aus Wind und Sonne zunimmt, ist das Stromnetz vielerorts nicht entsprechend mitgewachsen. Die Internationale Energieagentur (IEA) weist seit Jahren darauf hin, dass Strom – anders als fossile Energieträger – schwer zu handeln und zu transportieren ist. Länder brauchen dafür direkte Leitungsverbindungen, sogenannte Interkonnektoren.
Update 30. April: Stromausfall forderte drei Todesopfer
In der nordspanischen Gemeinde Taboadela in Galizien hat der Stromausfall drei Menschen das Leben gekostet. Um ein Beatmungsgerät in Betrieb zu halten, setzten sie einen Generator ein – dabei kam es unbemerkt zur Freisetzung von Kohlenmonoxid.
Wie die Behörden mitteilen, handelt es sich bei den Opfern um ein Ehepaar im Alter von 81 und 77 Jahren sowie deren 56-jährigen Sohn. Der Generator, den die Familie nach dem großflächigen Stromausfall am Montag eingeschaltet hatte, befand sich im Erdgeschoss des Wohnhauses. Offenbar war eine Verbindungstür zur Wohnung nicht geschlossen, wodurch sich das giftige Gas in die oberen Räume ausbreiten konnte.
Die Tragödie wurde am Dienstag gegen 13 Uhr entdeckt. Eine Pflegekraft, die regelmäßig nach dem älteren Ehepaar sah, schlug Alarm, nachdem niemand die Tür öffnete. Daraufhin informierte sie den stellvertretenden Bürgermeister, der wiederum die Guardia Civil verständigte. Die Einsatzkräfte fanden alle drei Familienmitglieder leblos in ihrem Haus vor.
Der Grund für den Blackout, der fast ganz Spanien, Portugal und Teile von Frankreich lahmlegte, ist nach wie vor nicht gefunden. Es bleibt daher bei den Spekulationen, über die wir in den vergangenen Tagen bereits ausführlich berichtet haben.
Stromausfall in Spanien führt zu Milliardenschäden
Der Stromausfall hat in Spanien gravierende wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen: Zahlreiche Supermärkte mussten verdorbene Lebensmittel entsorgen, und viele Unternehmen waren gezwungen, ihre Produktion vorübergehend einzustellen. Der spanische Unternehmerverband CEOE beziffert den entstandenen Schaden auf rund 1,6 Milliarden Euro – das entspricht etwa 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Laut der Zeitung El País schätzen einige Fachleute die Verluste sogar deutlich höher ein, nämlich auf 2,25 bis 4,5 Milliarden Euro. Andere Experten hingegen gehen von geringeren Auswirkungen aus, da ein Teil der ausgefallenen Produktion im Laufe des Jahres möglicherweise nachgeholt werden kann.
Update 29. April: 99 % der Stromversorgung in Spanien wiederhergestellt
Am frühen Dienstagmorgen meldete der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica, dass 99 % des Stromnetzes wieder in Betrieb seien. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte zuvor bereits versichert, dass mit einer Rückkehr zum Normalzustand gerechnet werden könne. Die Behörden arbeiteten die ganze Nacht über daran, die Stromversorgung schrittweise wiederherzustellen.
„Eine lange Nacht mit viel Arbeit“, kommentierte Sánchez die Bemühungen. Besonders betroffen war die Hauptstadt Madrid: Neun Stunden lang war sie nahezu vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten. Gegen späten Abend begannen dort wie auch in anderen Regionen – darunter Katalonien, Aragonien, das Baskenland, Galicien, Asturien, Navarra und Valencia – die Lichter wieder zu leuchten.
Auch in Portugal kehrt der Strom zurück
Im Nachbarland Portugal sieht es ähnlich aus. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender RTP konnte der Netzbetreiber E-Redes die Versorgung für 95 % seiner rund 6,5 Mio. Kundinnen und Kunden wiederherstellen. Die größte Herausforderung lag in der Synchronisierung mit dem spanischen Netz. Denn das Problem nahm offenbar dort seinen Ursprung.
Freudenausbrüche in der Nacht
Als die Stromversorgung in Teilen Spaniens zurückkehrte, war die Erleichterung spürbar. In Madrid hörte man laute Jubelrufe durch offene Fenster. Menschen sangen „Y Viva España“ von ihren Balkonen, aus fahrenden Autos drangen Rufe wie „Siii“ und „Vivaaa“. Es war ein emotionaler Moment für viele, die den plötzlichen Ausfall und die Unsicherheit stundenlang durchstehen mussten.
Ein seltenes Wetterphänomen?
Die genaue Ursache des Blackouts ist weiterhin unklar. Während die spanische Regierung alle Möglichkeiten offenhält, gibt es erste Hinweise auf eine wetterbedingte Störung. Laut dem portugiesischen Netzbetreiber REN war ein „seltenes atmosphärisches Phänomen“ im spanischen Netz der Auslöser für die Probleme, die sich bis nach Portugal ausbreiteten.
Dieses Phänomen habe technische Abläufe im Stromnetz beeinflusst und eine Kettenreaktion ausgelöst. Gestern wurde bereits in Portugal spekuliert, dass es sich dabei um einen Sonnensturm gehandelt haben könnte. Allerdings ist dies ziemlich unwahrscheinlich, meint Dr. Dr. Jens Berdermann, kommissarischer Direktor des Instituts für Solar-terrestrische Physik des DLR in Neustrelitz. Ein Leser dieses Beitrags hat bei ihm nachgefragt, ob ein Sonnensturm aufgrund der Monitoringdaten der vergangenen Woche in Betracht gezogen werden könne.
War es doch Sabotage?
Nach dem großflächigen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ermittelt die spanische Justiz nun wegen des Verdachts auf „Computer-Sabotage“. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat ein Richter am für schwere Straftaten zuständigen Gericht Audiencia Nacional eine Voruntersuchung eingeleitet. Sollte sich herausstellen, dass der Ausfall auf einen gezielten Angriff auf die strategische Infrastruktur zurückzuführen ist, könnte dies als „Terrorakt“ gewertet werden. Noch kurz zuvor hatte der Netzbetreiber Red Eléctrica eine Cyberattacke als Ursache ausgeschlossen.
Fünf Sekunden reichten aus, um das Land in Chaos zu versetzen
Die Ursache das Stromausfalls ist weiter unbekannt, die spanische Zeitung El Pais berichtete am 29. April jedoch wie folgt: „Am Montag um 12:33 Uhr verschwanden in Spanien plötzlich für fünf Sekunden 15 Gigawatt (GW) Stromerzeugung aus dem Netz. Regierungsquellen erklären, dass dies 60 Prozent des Stroms entsprach, der zu diesem Zeitpunkt im Land verbraucht wurde. Es brauchte nur diese fünf Sekunden, um am Montag ein Chaos auszulösen. Das System brach zusammen, aber die Ursache bleibt unbekannt.“
Das Science Media Center (smc) hat Experten befragt, warum das fünf Sekunde lange Verschwinden von 15 GW Leistung einen landesweiten Stromausfall auslösen kann. Prof. Dr. Christian Rehtanz vom Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft der TU Dortmund antwortete folgendermaßen:
„Im europäischen Verbundsystem beträgt die gesamte kurzfristige Regelleistung 3 GW. Diese deckt den Ausfall der zwei bis drei größten oder mehrerer kleinerer Kraftwerksblöcke ab. Man geht davon aus, dass innerhalb von Minuten nicht mehrere unabhängige Ausfall-Ereignisse quasi zeitgleich auftreten. Wenn mehr Leistung ausfällt, verringert sich die Frequenz und es kann zu weiteren Abschaltungen von Stromerzeugern bis hin zum Blackout kommen. Wobei vielfach noch manuell eingegriffen wird, um das System zu stabilisieren, so dass es nur sehr selten zu Blackouts kommt.“
Prof. Dr. Veit Hagenmeyer, Leiter des Instituts für Automation und angewandte Informatik am KIT, äußerte sich gegenüber smc folgendermaßen zu der Thematik: „Es gibt mehrere Stabilitätsfaktoren im Netz, eine ist die Frequenzstabilität. Das heißt, wenn Last und Erzeugung genau im Gleichgewicht sind, wird überall in Europa eine Frequenz von 50 Herz gehalten. Wenn weniger Strom verbraucht wird als erzeugt, dann steigt die Frequenz, wenn mehr Strom verbraucht wird, sinkt sie. Das sind in der Regel aber nur kleine Schwankungen, sie werden im Millisekunden-Takt ausgeglichen.“
Hagenmeyer weiter: „Nun sind in Spanien den Berichten zufolge rund 60 % der Leistung weggebrochen, in nur fünf Sekunden. Das Stromnetz in Europa ist nicht dafür ausgelegt, dass so viel Erzeugungsleistung ausfällt. Es ist ausgelegt für einen Verlust von 3 GW, viel weniger. Das heißt, den Ausfall eines großen Kraftwerks oder mehrerer kleinerer kann das Netz vertragen, aber nicht diese Menge. Dann greifen automatische Abschaltvorrichtungen, die Kraftwerke, Wind- oder PV-Anlagen, Verbraucher, aber auch Stromleitungen oder Umspannanlagen abschalten – um diese vor Schäden zu schützen“.
Womit hätte ein Stromausfall dieser Größenordnung verhindert werden können?
Das smc hat Prof. Dr. Christian Rehtanz auch befragt, wie das Chaos hätte verhindert werden können. Hier seine Erklärung:
„Grundsätzlich sind ausreichende Netzkapazitäten und regelbare Kraftwerkskapazitäten in einem Energiesystem erforderlich. Diese dürfen nicht zu knapp ausgelegt sein. Hierzu gibt es langjährige Erfahrungswerte, die man nicht durch mangelnden Leitungsausbau oder zu schnellen Kraftwerksrückbau bei der Energiewende unterschreiten darf. Das europäische Verbundsystem mit den gegenseitigen Hilfemöglichkeiten wirkt hierbei immens stabilisierend und sichert die Versorgung großräumig. Hier hat die iberische Halbinsel natürlich eine besondere Lage gegenüber zum Beispiel Deutschland, welches viele Nachbarländer hat, die aushelfen könnten.“
Prof. Miguel de Simón Martín vom Fachbereich Elektronik der Universität León erklärte gegenüber smc die Besonderheiten des spanischen Stromnetzes: „Das spanische Festlandnetz ist dank seines hohen Anteils an Hoch- und Höchstspannungsnetzen sowie seiner großen synchronen Erzeugungskapazität (Wasser- und Wärmekraftwerke) seit jeher robust und zuverlässig. Seine Schwachstelle war jedoch schon immer die begrenzte internationale Vernetzung, die durch die geografische Barriere der Pyrenäen bedingt ist. Derzeit beträgt die Austauschkapazität mit Europa kaum 3 % der installierten Kapazität (3.977 MW von 132.343 MW) und liegt damit weit hinter dem in der Energie- und Klimaschutzpolitik der EU für 2030 festgelegten Ziel von 15 % zurück.“
Der Stromausfall steht nicht im Zusammenhang mit einer „Dunkelflaute“
In Deutschland wird bei Stromausfällen häufig auf das Phänomen der sogenannten „Dunkelflaute“ verwiesen – also eine Situation, in der weder Wind noch Sonne ausreichend Energie liefern, um das Stromnetz stabil zu halten. Besonders kritisch wird es, wenn es sowohl windstill als auch dunkel ist. Im Fall des Blackouts auf der Iberischen Halbinsel steht jedoch fest, dass eine Dunkelflaute nicht die Ursache war.
Auch ein flächendeckender Netzzusammenbruch wie in Spanien und Portugal gilt hierzulande als äußerst unwahrscheinlich. Der Grund: Das deutsche Stromnetz ist durch redundante Strukturen besonders robust aufgebaut. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erläutert das so:
„Techniker sprechen von einer N-1-Struktur. Konkret bedeutet das, dass eine Leitung immer ausfallen kann und eine andere Leitung einspringen würde. Das heißt, wir haben mehrere Sicherungssysteme im deutschen Stromnetz.
Und natürlich für den Fall der Fälle hätten wir Kraftwerke, sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke, die ein solches Netz wieder aufbauen könnten.“
Ein „Schwarzstart“ bedeutet dabei, dass das Kraftwerk auch ohne externe Stromzufuhr in Betrieb genommen werden kann. Müller kommt daher zu dem Schluss, dass Deutschland gut gerüstet ist.
Kann die eigene Solaranlage bei Stromausfall helfen?
Viele stellen sich die Frage: Lässt sich ein Stromausfall mit der eigenen Photovoltaikanlage überbrücken? So einfach ist das leider nicht. Zwar erzeugt die Anlage selbst Strom, doch benötigt sie gleichzeitig auch Strom, um überhaupt in Betrieb zu gehen. Denn bevor Strom ins Haus- oder öffentliche Netz eingespeist werden kann, muss der erzeugte Gleichstrom über einen sogenannten „Wechselrichter“ in nutzbaren Wechselstrom umgewandelt werden. Dieser Wechselrichter wiederum benötigt selbst Strom für seine Funktion. Fällt dieser aus, arbeitet auch die Solaranlage nicht.
Zwar besteht die theoretische Möglichkeit, den Wechselrichter über einen Stromspeicher zu versorgen, in der Praxis ist das jedoch bei größeren Anlagen kaum realisierbar. Zudem schreibt die deutsche Gesetzgebung vor, dass solche Anlagen ans öffentliche Netz angeschlossen sein müssen.
Anlagen mit Notstromfunktion als Alternative
Mittlerweile gibt es aber auch Anlagen mit Notstromfunktion. Kommt es zu einem Stromausfall, erkennt der Wechselrichter diesen sofort und reagiert automatisch: Er trennt das Hausnetz vom öffentlichen Netz und versorgt das Gebäude über die Photovoltaikanlage und den angeschlossenen Speicher.
Dieser Vorgang erfolgt in Sekundenschnelle und ohne merkliche Unterbrechung der Stromversorgung im Haus. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass genügend Energie in der Solaranlage oder dem Speicher verfügbar ist – andernfalls kann es trotz Systemumschaltung zu einem Stromausfall kommen. Sie sollten im Falle eines Stromausfalls zudem auf stromintensive Geräte wie Elektroherd, Waschmaschine oder Klimaanlage verzichten, sonst ist der Notstrom schnell aufgebraucht.
Was ebenfalls möglich ist, ist der Aufbau eines kleinen, unabhängigen „Inselnetzes“. Solche autarken Mini-Stromversorgungen finden sich beispielsweise in Wohnmobilen oder auf abgelegenen Hütten. Allerdings ist die dabei erzeugbare Strommenge stark begrenzt.
Meldung vom 28. April: Cyberangriff? Hinweise fehlen
Unmittelbar nach dem Ausfall kamen Spekulationen über einen möglichen Cyberangriff auf. Das spanische nationale Institut für Cybersicherheit untersucht laut El País diese Möglichkeit. EU-Ratspräsident António Costa erklärte jedoch: „Es gibt derzeit keinen Hinweis auf einen Cyberangriff.“
Auch die EU-Kommission beobachtet die Situation genau. „Die Kommission wird die Lage weiterhin überwachen und einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten sicherstellen“, teilte sie in Brüssel mit.
Sven Herpig von der Berliner Denkfabrik Interface hält einen Cyberangriff ebenfalls für unwahrscheinlich. „Es ist zwar theoretisch möglich, Teile des Stromnetzes mit einer Cyberoperation zu manipulieren oder lahmzulegen. Doch der Aufwand ist immens“, sagte er gegenüber t-online. Für einen solchen Angriff sei tiefgehendes Wissen über industrielle Steuerungssysteme nötig. Zudem stelle sich die Frage: „Warum sollte ausgerechnet Spanien an einem warmen Frühlingstag Ziel eines solchen Angriffs sein?“
Technische Ursachen rücken in den Fokus
Statt eines Hackerangriffs hält Herpig eine technische Ursache wie einen Brand für wahrscheinlicher. Erste Hinweise deuten auf ein seltenes atmosphärisches Phänomen hin, das möglicherweise eine Störung im Stromnetz auslöste. Portugals Stromnetzbetreiber REN berichtete, der Blackout in Portugal sei auf eine Störung in Spanien zurückzuführen, die durch eben ein solches Phänomen verursacht wurde.
Bis zur vollständigen Normalisierung des Stromnetzes könne es noch bis zu einer Woche dauern. Aktuell ist die Ursache noch nicht vollständig geklärt. Möglicherweise könnten auch die Temperaturschwankungen die Ursache gewesen sein, die für die Überlastung gesorgt haben.
Ist die Insel- bzw. Halbinsellage der Grund?
„Der landesweite Stromausfall in Spanien am Montag hat die Anfälligkeit sogenannter Insel- und Halbinselnetze gezeigt, trotz internationaler Verbesserungen bei Redundanz und Prognosefähigkeiten in den letzten Jahren“, so Jean-Paul Harreman, Direktor von Montel Analytics.
Harreman sagte, dass der Stromausfall zwar ein „beispielloses Ereignis in modernen Energiemärkten“ sei, der Stromausfall in Spanien und Portugal jedoch „nicht besonders überraschend“ sei, da „Länder, die am Rande des synchronen europäischen Netzes liegen und stärker davon isoliert sind, tendenziell leichter Netzfrequenzabweichungen feststellen“.
„In Inselsystemen wie Großbritannien und Irland oder Halbinselsystemen wie Italien und Spanien ist die synchrone Wechselstromverbindung mit anderen Ländern viel geringer, was zu einem anfälligeren Netz führt, da Flexibilität und Widerstandsfähigkeit größtenteils aus dem Inneren kommen müssen“, sagte er.
Experte warnt vor Kaskadeneffekten und fordert stärkere Absicherung
Arne Schönbohm (55), früherer Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und derzeit Professor am Institut für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, sieht technisches Versagen als wahrscheinlichste Ursache für die aktuellen Vorfälle. Gegenüber BILD sprach er konkret von möglichen „Bedienfehlern bei der Netzwerksynchronisierung“.
In diesem Zusammenhang verwies Schönbohm auf die Struktur des europäischen Stromnetzes. Es handele sich um „ein eng verknüpftes, vermaschtes System“. Das bedeutet: Störungen in einem Netzbereich können kaskadenartige Auswirkungen haben und ganze Regionen lahmlegen.
Um solchen Risiken entgegenzuwirken, müsse die Widerstandsfähigkeit des Netzes dringend verbessert werden. Schönbohm betonte: „Eine zentrale Maßnahme besteht darin, stärkere Netzwerksegmentierungen einzuführen – sogenannte Inselnetze –, die im Falle einer Störung autonom weiter betrieben werden können.“ Dadurch könnten großflächige Blackouts verhindert und Stromausfälle auf einzelne Gebiete begrenzt werden.
Die jüngsten Ereignisse zeigen aus Sicht Schönbohms klar, dass gezielte Investitionen und strukturierte Notfallpläne notwendig sind, um die Resilienz des europäischen Stromnetzes langfristig zu stärken.
Folgen des Stromausfalls
Reporterinnen und Reporter berichteten aus Städten wie Madrid und Barcelona von großflächigen Stromausfällen. Der Alltag kam vielerorts zum Erliegen: Menschen mussten aus Aufzügen und U-Bahntunneln befreit werden. Krankenhäuser blieben dank Notstromaggregaten weiterhin funktionsfähig.
Geschäfte, insbesondere Eisdielen und Läden mit verderblichen Waren, schlossen ihre Türen. In Premià de Mar bei Barcelona bangte eine Verkäuferin um ihre Ware: „Ein paar Stunden halten wir noch aus, dann wird das Eis flüssig.“ Auch auf den Straßen war der Stromausfall spürbar. Ampeln fielen aus, der Verkehr geriet ins Stocken.
Auswirkungen auf Verkehr und Energieversorgung
Die Eisenbahngesellschaft Renfe meldete, dass alle Züge auf dem Festland stillstanden. Eine Wiederaufnahme des Verkehrs war zunächst nicht absehbar. Auch Flughäfen wie Madrid-Barajas spürten die Auswirkungen. Zwar liefen Notfallgeneratoren, doch Reisende mussten sich auf Verzögerungen einstellen. Bilder des Senders RTVE zeigten gestrandete Passagiere und ausgefallene Rolltreppen.
Drei spanische Atomkraftwerke – Almaraz II, Ascó I und II sowie Vandellós II – wurden vorsorglich in den Notstrombetrieb versetzt. Der spanische Nukleare Sicherheitsrat betonte, dass die Anlagen weiterhin in einem sicheren Zustand seien.
Während das spanische Festland und Portugal massiv betroffen waren, blieben die Balearen und Kanarischen Inseln weitgehend verschont. In Andorra fiel der Strom nur für wenige Sekunden aus, da die Versorgung schnell über Frankreich wiederhergestellt wurde. Auch im französischen Baskenland kam es kurzzeitig zu Stromausfällen.
Spanien erlebt kritische Stunden
Ministerpräsident Sánchez beschrieb die Situation als „kritische Stunden“. Er betonte, dass alle möglichen Ursachen geprüft würden, riet jedoch zur Zurückhaltung bei Spekulationen. Besonders lobte er die schnelle Unterstützung durch Frankreich und Marokko, die bei der Wiederherstellung der Versorgung geholfen haben.
In Deutschland bleibt die Lage ruhig. Die Bundesnetzagentur erklärte, dass ein großflächiger Blackout hierzulande unwahrscheinlich sei. „Das elektrische Energieversorgungssystem ist redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen“, so eine Sprecherin. (mit dpa)
Ein Beitrag von:



















