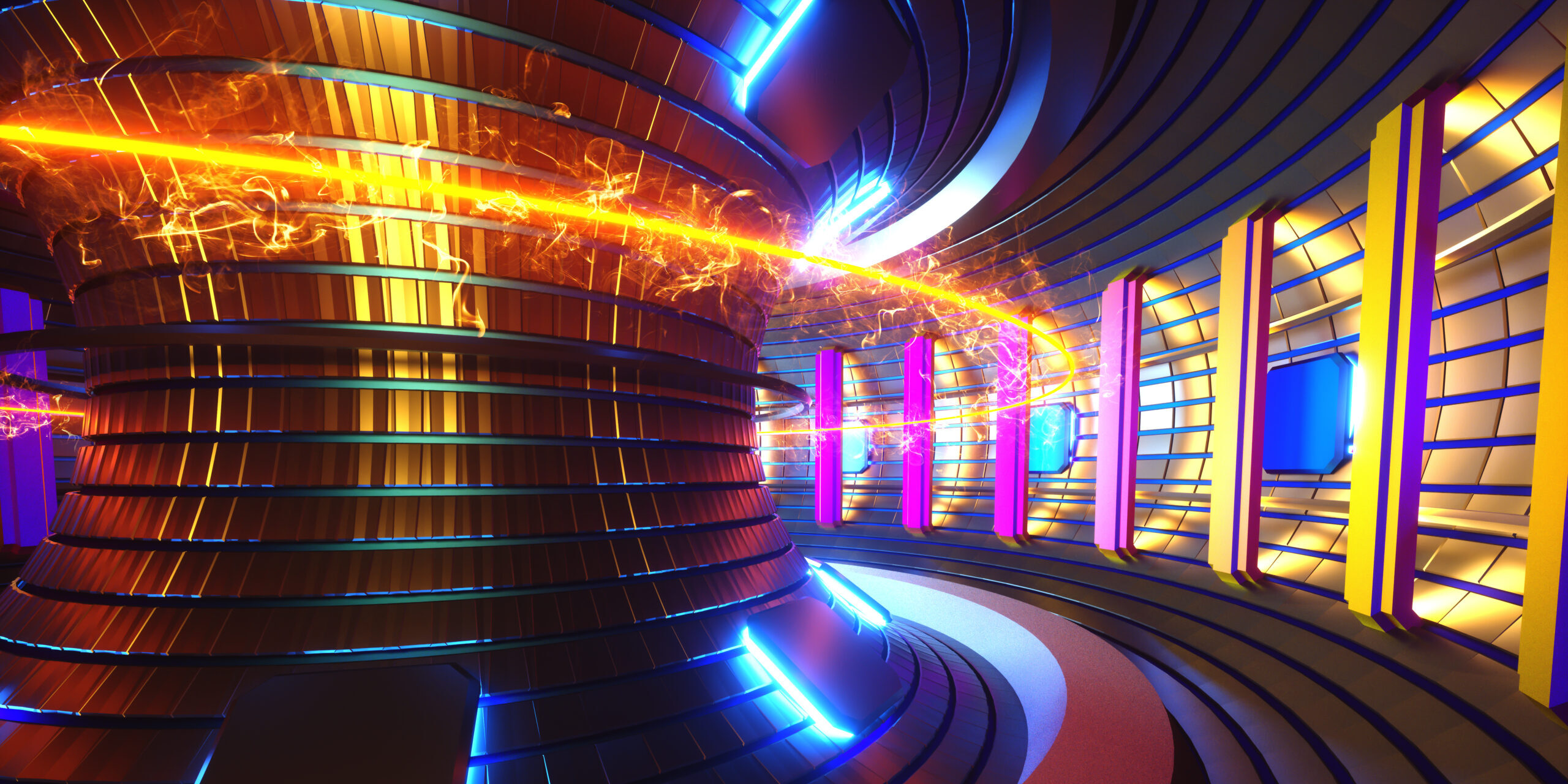Vergessenes Fusions-Experiment von 1938 neu entdeckt
Ein 85 Jahre altes Fusions-Experiment wurde erneut durchgeführt – mit erstaunlich aktuellen Folgen für Forschung und Technik.

Bei der Kernfusion verschmelzen bei extrem hohen Temperaturen Deuterium und Tritium zu Helium – dabei wird enorme Energie freigesetzt.
Foto: Smarterpix / diuno
Ein fast übersehenes Experiment aus dem Jahr 1938 steht plötzlich wieder im Zentrum der modernen Fusionsforschung. Physikerinnen und Physiker aus den USA haben ein historisches Fusions-Experiment des damaligen Doktoranden Arthur Ruhlig reproduziert – und damit neue Erkenntnisse zur Deuterium-Tritium-Fusion (DT-Fusion) gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- Spurensuche im Archiv
- Ruhligs Beobachtung: Ein Zufall mit Folgen
- Ein Netzwerk aus Erinnerungen
- Die Entscheidung: Replikation statt Spekulation
- Aufbau des Versuchs
- Ergebnis: qualitativ richtig, quantitativ zu hoch
- Bedeutung für heutige Fusionsforschung
- Ruhligs Weg: Vom Doktoranden zum Entwickler von Lasersystemen
Spurensuche im Archiv
Alles begann mit einer Recherche des Physikers Mark Chadwick am National Security Research Center in Los Alamos. Eigentlich wollte er die Anfänge der Fusionsforschung dokumentieren. Doch eine alte Tonaufnahme des bekannten Physikers Emil Konopinski aus dem Jahr 1986 brachte ihn auf eine neue Spur. In der Aufnahme sprach Konopinski über seine Erkenntnisse zur DT-Fusion – und verwies dabei mehrfach auf Forschung „vor dem Krieg“.
Chadwick begann zu graben. Zusammen mit seinem Kollegen Mark Paris von der TU Wien analysierte er alte Fachartikel. Schließlich stießen sie auf eine Veröffentlichung in Physical Review aus dem Jahr 1938. Der Verfasser: Arthur J. Ruhlig, damals Doktorand an der University of Michigan.
Ruhligs Beobachtung: Ein Zufall mit Folgen
In seinem Artikel untersuchte Ruhlig Deuterium-Deuterium-Reaktionen. Dabei beschoss er Deuterium mit Deuteronen – das sind Kerne von Deuteriumatomen, bestehend aus einem Proton und einem Neutron. In einer Nebelkammer beobachtete er dabei überraschend energiereiche Protonen. Ruhlig vermutete: Diese könnten das Ergebnis einer sekundären Reaktion zwischen Tritium und Deuterium sein – einer DT-Fusion.
Er formulierte eine Hypothese: Wenn Deuterium und Tritium sich nahe genug kommen, sei die Wahrscheinlichkeit einer Fusion sehr hoch. Seine Schätzung: Ein energetisches Proton pro tausend weniger energiereiche. In einem privaten Gespräch soll er diese Beobachtung sogar mit dem renommierten Physiker Hans Bethe diskutiert haben.
Doch der Artikel geriet in Vergessenheit. Ruhligs Hinweis auf die DT-Fusion war nur eine Randnotiz in einem Brief an die Redaktion – und fand kaum Beachtung in der Fachwelt.
Deuterium und Tritium: Brennstoffe der Fusion
In Fusionsreaktoren gelten Deuterium und Tritium als bevorzugte Ausgangsstoffe. Deuterium ist eine Variante des Wasserstoffs und in Meerwasser in großer Menge enthalten – es lässt sich einfach und kostengünstig gewinnen. Tritium dagegen ist nur in sehr geringen Mengen natürlich vorhanden. Es handelt sich um ein radioaktives Wasserstoffisotop, das aktuell vor allem in bestehenden Kernspaltungsanlagen als Nebenprodukt entsteht. Da viele dieser Reaktoren stillgelegt werden, könnte die Tritiumversorgung künftig zur Herausforderung für die Fusionsforschung werden.
Ein Netzwerk aus Erinnerungen
Chadwick und Paris kombinierten nun weitere Informationen: Ruhlig und Konopinski waren beide zur gleichen Zeit an der University of Michigan, hatten gemeinsame Mentoren und kannten vermutlich die Arbeit des jeweils anderen. Obwohl Ruhligs Arbeit nicht häufig zitiert wurde, könnte sie sehr wohl bekannt gewesen sein – zumindest Konopinski scheint sich erinnert zu haben.
Das Team stellte sich eine zentrale Frage: Was genau hatte Ruhlig damals beobachtet? Und war seine Vermutung über die DT-Fusion tatsächlich korrekt?
Die Entscheidung: Replikation statt Spekulation
Chadwick sprach mit dem Direktor des Los Alamos National Laboratory, Thom Mason. Der entschied: Eine bloße theoretische Analyse reiche nicht. Das historische Experiment müsse wiederholt werden.
Für die Replikation arbeiteten die Forschenden mit dem Triangle Universities Nuclear Laboratory an der Duke University zusammen. Ziel war es, das ursprüngliche Setup möglichst genau nachzubilden – aber unter heutigen Sicherheits- und Messstandards.
Aufbau des Versuchs
Das moderne Experiment nutzte einen sogenannten Tandem-Beschleuniger, der einen Deuteronenstrahl mit geringer Energie erzeugte. Dieser traf auf ein Ziel aus deuterierter Phosphorsäure – ähnlich wie bei Ruhlig. Eine dünne Metallfolie trennte die Vakuumkammer vom Zielbereich. Neutronendetektoren erfassten die Reaktionen.
Entscheidend war: Der Deuterium-Deuterium-Prozess erzeugt in einem Zwischenschritt Tritium, das anschließend mit weiterem Deuterium fusionieren kann – also genau die Reaktion, die Ruhlig vermutet hatte.
„Im Gegensatz zu heutigen Hochenergie-Versuchen wie an der National Ignition Facility konnten wir erstmals eine DT-Fusion als Sekundärprozess bei niedriger Energie nachweisen“, erklärte Werner Tornow, Physiker an der Duke University.
Ergebnis: qualitativ richtig, quantitativ zu hoch
Die Auswertung bestätigte: Ruhlig hatte in der Tendenz recht. Die DT-Fusion tritt in solchen Konstellationen auf. Allerdings überschätzte er offenbar die Anzahl der resultierenden hochenergetischen Protonen deutlich. Seine Schätzung von 1 zu 1.000 erwies sich als zu hoch.
Das ist nicht verwunderlich. Ruhligs Originalexperiment enthielt nur wenige Details zur Methodik – und die Messtechnik war 1938 deutlich weniger präzise als heute.
Trotzdem war die qualitative Beobachtung korrekt. Das moderne Experiment bestätigte die Existenz der Sekundärreaktion – ein zentraler Punkt für die spätere Entwicklung von Fusionstechnologien.
So läuft die Deuterium-Tritium-Fusion ab
Bei der Fusion von Deuterium (D) und Tritium (T) entsteht ein Heliumkern und ein energiereiches Neutron. Die Reaktionsgleichung lautet:
D + T → He⁴ (3,5 MeV) + n (14,1 MeV)
Insgesamt werden pro Reaktion 17,6 Megaelektronenvolt (MeV) freigesetzt – das entspricht einer enormen Energiemenge auf atomarer Skala. Das Neutron trägt den Großteil dieser Energie und kann zum Erhitzen von Materialien oder zur Energiegewinnung genutzt werden.
Bedeutung für heutige Fusionsforschung
Die Erkenntnisse sind nicht nur historisch interessant. Die Ergebnisse fließen direkt in moderne Fusionsprojekte ein – etwa in die Entwicklungen an der National Ignition Facility (NIF). Dort wird die DT-Fusion gezielt angesteuert, um nutzbare Energie aus der Fusion zu gewinnen.
„Ruhligs zufällige Beobachtung trug dazu bei, die Grundlage für die spätere friedliche Nutzung der Fusion zu legen – etwa in Tokamaks oder in Trägheitsfusionsexperimenten“, sagt Chadwick.
Bemerkenswert: Die Ergebnisse des wiederholten Experiments wurden erneut in Physical Review veröffentlicht – derselben Zeitschrift, in der Ruhligs Originalartikel 1938 erschien.
Ruhligs Weg: Vom Doktoranden zum Entwickler von Lasersystemen
Arthur Ruhlig wurde 1912 in Michigan geboren. Nach seinem Studium und der Promotion arbeitete er zunächst am Naval Research Laboratory. Dort forschte er unter anderem an atmosphärischen Messungen mit Raketen. Später wechselte er zu Aeronutronic, einem Forschungsunternehmen der Ford Motor Company, wo er sich mit Radartechnik und Laserentwicklung beschäftigte.
Obwohl Ruhlig für seine Beobachtung zur DT-Fusion nie offiziell ausgezeichnet wurde, galt er als vielseitiger Physiker mit breitem Fachwissen. In der Fachwelt wurde er als integrer, engagierter Wissenschaftler mit tchnischem Weitblick beschrieben. Ruhlig starb 2003 in Kalifornien.
Ein Beitrag von: